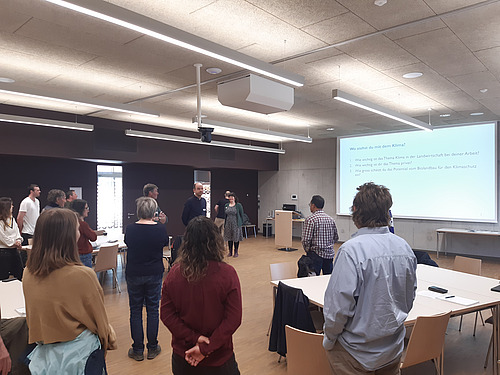Agri-Photovoltaik stellt ein interessantes Potenzial für Synergien zwischen der erneuerbaren Energiegewinnung einerseits, und dem Schutz der Kulturen von (extremen) Witterungseinflüssen andererseits dar. Foto: Stephanie Hoch, FiBL
Der Umfang und die Komplexität des Themas wurden während des facettenreichen Programms des Klimatags am FiBL in Frick einmal mehr deutlich. Klima ist systemisch: Ursachen und Auswirkungen von Effekten sind oftmals nur bedingt isolierbar und viele Faktoren interagieren miteinander über die Grenzen praktischer Teilbereiche hinaus. Am Klimatag wurde das Thema auf den für die Praxis besonders relevanten Ebenen Boden, Pflanzen, Tiere und der Zusammenarbeit untereinander beleuchtet. Der Anlass wurde von Lin Bautze, FiBL Forscherin in der Gruppe Bodenfruchtbarkeit & Klima, moderiert.
Praktischer Klimaschutz: Boden als möglicher Lösungsansatz?
Den Auftakt zur ersten Einheit machte Jan Landert vom FiBL Departement für Agrar- und Ernährungssysteme. Er zeigte in seinem Beitrag Erkenntnisse aus dem KlimaCrops-Projekt auf. Das Projekt sollte Aufschluss darüber geben, wie sich Klimaveränderungen heute und in Zukunft konkret auf Landwirtschaftsbetriebe im trinationalen Gebiet des Oberrheins auswirken. Anhand beispielhafter Musterbetriebe wurde modelliert, ob und wie Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und damit verbundener Ertragsausfälle beitragen können.
Massnahmen wie Mulch- und Direktsaat, Transfermulch, neue Kulturen in der Fruchtfolge und Agroforst waren im Fazit für die Betriebe mögliche Klimaanpassungsmassnahmen. Bei alternativen Kulturen wie Sorghumhirse bleiben gemäss Landert Fragen offen, ob sich eine ausreichende Nachfrage einstelle und auf welchen Vermarktungswegen diese erreicht werden könne. Bodenbedeckung, bodenschonende Bearbeitung und neue Kunstwiesenmischungen konnten im Modell als vorteilhafte Ansätze ermittelt werden.
Im Anschluss an den ersten Beitrag führte FiBL Bodenwissenschaftler Markus Steffens in die Systematik und wissenschaftliche Begrifflichkeit von Kohlenstoff und Humus ein. Er zeigte einerseits die positiven Einflüsse der organischen Bodensubstanz auf Bodeneigenschaft wie tiefere Lagerungsdichte, Aggregatstabilität, Wasserhaushalt und Nährstoffverfügbarkeit auf. Andererseits seien Analytik, Gehalt und Bestimmung des klimarelevanten Kohlenstoffs in der organischen Bodensubstanz relativ aufwendig und variieren stark. Im Kontext von finanziellen Kompensationsprojekten, bei denen Landwirt*innen für den gespeicherten Kohlenstoff bezahlt werden, können die entsprechenden Mengen nur schwer bestimmt werden.
Spassverderber Lachgas
Nächster Programmpunkt war der Themenblock Pflanzen, der mit einem Referat von Hans-Martin Krause startete. Er ist FiBL Projektleiter des weltweit einmaligen DOK-Langzeitversuchs, bei dem seit 1978 biologisch-dynamische (D), organischen (O) und konventionelle (K) Anbausysteme miteinander verglichen werden. Krause berichtete unter anderem über die Auswirkung der Düngeverfahren der verschiedenen Anbausysteme auf den Bodenkohlenstoff und Unterschiede in den gemessenen Treibhausgasemissionen der Systeme.
Von den verschiedenen Anbausystemen speicherte ausschliesslich das biodynamische Verfahren mit praxisüblicher Düngung zusätzlichen organischen Kohlenstoff im Boden. Im BIODYN-System wurden ausserdem die geringsten Lachgasemissionen gemessen. Krause wies auf die entscheidende Wirkung von Lachgas im Ackerbau auf das Klima hin. «Lachgas muss bei Überlegungen rund um eine klimaresiliente Landwirtschaft unbedingt mitgedacht werden», so der Forscher. Er plädierte ausserdem dafür, die Humuswirtschaft nicht ausschliesslich auf den Aspekt des Klimas zu reduzieren. Das führe zu einer Unterbewertung ihrer Bedeutung in Bezug auf Biodiversität, Nährstoffe und das Wasser.
Steigerung der Landnutzungseffizienz als Strategie für künftige Generationen
Der Vormittag wurde mit einer Besichtigung der Agri-Photovoltaik (APV) Anlage auf dem Gelände des FiBL abgeschlossen. Bei prächtigen Wetterbedingungen präsentierte FiBL Projektleiter Stefan Baumann den Teilnehmenden das Pilotprojekt in einer der Obstanlagen des Forschungsinstituts. Ziel des AgriSolar-Projekts sei es unter anderem, erste Erfahrungen mit einer solchen Anlage zu sammeln und die Auswirkungen auf die Kulturen und mögliche Ertragseinbussen zu untersuchen.
Nach dem Mittagessen zeigte Agroforst-Experte Matthias Klaiss auf der kürzlich realisierten Anlage in Gehdistanz zum Forschungsinstitut dem Publikum die vielfältigen Funktionen und Nutzungen möglicher Agroforstsysteme auf.
Brisant: Kuh und Klima
Von einigen Teilnehmenden bereits mit Spannung erwartet, wurde am Nachmittag schliesslich das kontroverse Thema auf die Bühne geholt: Die Kuh. Kühe als wesentliche Quelle klimaschädlicher Methanemissionen bewegen die Gemüter. Denn werden die Wiederkäuer in der Vision einer nachhaltigen Landwirtschaft oftmals an den Pranger gestellt, sind sie im Gegensatz dazu stark mit Landwirtschaft und Kultur in unserem Land verwoben. Schliessen sich Nachhaltigkeit und die Produktion tierischer Produkte aber tatsächlich aus oder könnte das gar die falsche Frage sein? Diesem vermeintlichen Dilemma haben sich die beiden Beiträge von Florian Leiber und Catherine Pfeifer, beide vom FiBL, gewidmet.
Florian Leiber regte in einem beherzten Plädoyer für eine systemische Betrachtung im Umgang mit Fragen zur Zukunft der Tierhaltung an. Die zwei im Diskurs etablierten Narrative «Feed-no-Food» bzw. «Netto null» wollten zwar beide Antworten auf die Frage einer nachhaltigen Landwirtschaft liefern, wiedersprächen sich aber, so Leiber, gleichzeitig in ihren jeweiligen Aussagen. Die «Feed-no-Food»-Idee fordere zur Fütterung von Wiederkäuern die ausschliessliche Nutzung von Flächen, die nicht für die menschliche Ernährung genutzt werden können – sprich Grasland.
Methanreduktion als nachhaltige Klimastrategie?
In der Schweiz liege der Anteil Grasland an der Landwirtschaftlichen Nutzfläche gemäss Leiber bei rund zwei Dritteln. Im Sinne einer effizienten Landnutzung müssten diese Fläche auch künftig zur Fütterung von Wiederkäuern genutzt werden. Im Gegensatz dazu wolle «Netto null» die Methanemissionen aus der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung vermeiden bzw. reduzieren, was unter anderem durch moderne Technologien wie synthetische Futtermittelzusätze, erhöhter Kraftfuttermittel-Einsatz und effizientere Nutztiere umgesetzt werden solle.
Leiber erläuterte kritische Überlegungen zu diesen Massnahmen: Das Konzept stelle keinen ganzheitlichen, systemischen Ansatz dar und erwünschte Effekte wie die Methanreduktion bildeten Nachhaltigkeitsziele nur eindimensional ab. (Biologische) Landwirtschaft müsse nach dem Prinzip der Sorgfalt und Vorsorge betrieben werden. Er plädierte für ein klares Narrativ, in dessen Rahmen die Diskussion weitergeführt werden könne.
Vorteile durch längere Nutzung von Milchkühen
Mit ihren Ausführungen zur Berechnung der Treibhausgase am Beispiel der Nutzungsdauer, ergänzte Catherine Pfeifer die Einheit Tiere mit konkreten Werten. Die durchschnittliche Nutzung einer Milchkuh in der Schweiz belaufe sich auf ca. 3,5 Jahre. Eine längere Nutzungsdauer wirkt sich gemäss Pfeifer positiv auf Klima aus, da für die gleiche Menge produzierter Milch weniger Jungtiere aufgezogen werden müssten und es insgesamt weniger Tiere im System gebe.
Die Forscherin machte in ihrem Beitrag zudem auf die methodischen Herausforderungen von LCA-Modellierungen aufmerksam, die beispielsweise je nach verwendeter Systemgrenzen, Rechnungsfaktoren oder Bezugseinheiten in ihren Aussagen sehr variieren können.
Konkrete Ansätze: Beratungstools und Erfahrungsaustausch
Der Klimatag wurde abgerundet mit den Beiträgen zu «MeinHofKompass» und «ProBio». Das FiBL Projekt «MeinHofKompass» bietet ein niederschwelliges Instrument für Landwirt*innen, um auf Basis diverser Indikatoren den eigenen Betrieb auf Nachhaltigkeit zu überprüfen. Dabei können Handlungsspielräume identifiziert werden und die Produzent*innen können direkt auf Beratungsmaterial in den entsprechenden Bereichen zugreifen. Das Tool steht gemäss der Projektmitarbeitenden Phie Tanner ab Herbst 2025 zur kostenlosen Verfügung.
Bei Pro Bio handelt es sich um ein gemeinsames Beratungs- und Vernetzungsangebot für Praktizierende der Biobranche von Bio Suisse und dem FiBL. Interessierte Bäuerinnen und Bauern organisieren sich in regionalen Arbeitskreisen und tauschen sich regelmässig zu ausgewählten und relevanten Themen und Fragestellungen aus. Wertvoller Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Kolleg*innen könne so ermöglicht werden. Weitere Infos zu den Projekten sind unter den nachfolgenden Links erhältlich. Der Anlass wurde durch das «ClieNFarms» EU Horizon 2020 Projekt finanziert.
Stephanie Hoch, FiBL
Weiterführende Informationen
Klima (Rubrik Grundlagen, Kapitel Nachhaltigkeit)
Projekt KLIMACrops (fibl.org)
Projekt Klimaschutz durch Humusaufbau (fibl.org)
Projekt DOK-Versuch (offizielle Projektwebsite, fibl.org)
Projekt AgriSolar Forschung (offizielle Projektwebsite)
Agroforst (Rubrik Pflanzenbau)
Rindvieh (Rubrik Tierhaltung)
Projekt MeinHofKompass (offizielle Projektwebsite)
Projekt ProBio (offizielle Website)
Projekt ClieNFarms (offizielle Webiste)